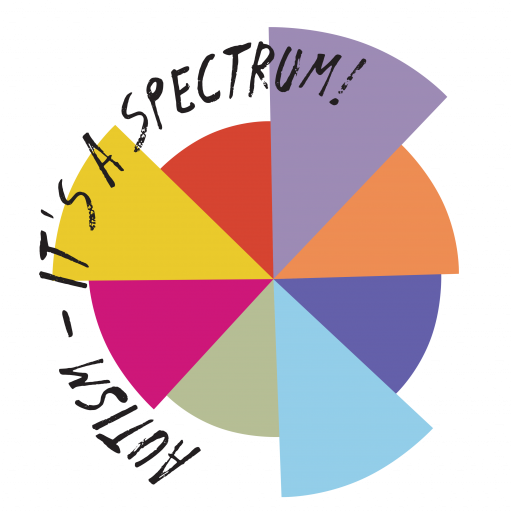Für das Leitbild in einfacher Sprache, hier klicken!
Einleitender Hinweis vom Special Forces Autism Team (kurz “SFAT”):
Unser Leitbild versteht sich als Orientierungshilfe, indem es einen Überblick über unsere Werte und Ziele gibt. Das Autismus-Spektrum weist eine Vielfalt von Merkmalen und Ausprägungsgraden auf. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in unterschiedlichen Meinungen über Autismus wider. Nur durch offene Dialoge und Kompromisse kann ein gemeinsamer Weggefunden werden. Dieser ermöglicht es, Erfahrungen zu sammeln, die zu mehr Sensibilisierung und Akzeptanz der Selbstbetroffenen führen.
- Neurodiversität (Basis):
Wir sind überzeugt, dass die Menschheit in ihrer Art grundlegend divers ist. Kein Mensch gleicht dem anderen exakt in Aussehen, Denkweise oder Verhalten. Selbst eineiige Zwillinge besitzen verschiedene Fingerabdrücke und unterscheiden sich in ihrem Wesen.
Der Begriff Neurodiversität beschreibt die natürlichen Unterschiede im menschlichen Gehirn. Das Konzept der Neurodiversität wurde von der australischen Soziologin Judy Singer geprägt. Die Bewegung setzt seit den 1990er Jahren ihren Fokus auf Inklusion, Akzeptanz und Gleichberechtigung. Zugleich wendet sie sich gegen Pathologisierung1, Diskriminierung 2und gesellschaftliche Stigmatisierung 3von Menschen, die von der neurotypischen Mehrheit abweichen. Judy Singer, die selbst Autistin ist, verfolgt bis heute das Ziel, neurodivergente Betroffene als Teil der menschlichen Vielfalt zu würdigen. Diese Vielfalt beinhaltet nicht nur Personen mit Autismus, sondern auch ADHS, Trisomie 21, Legasthenie, Dyskalkulie, Tourette-Syndrom, u.v.m.
Menschen, die der neurologischen Norm entsprechen, werden als ”neurotypisch” bezeichnet, während jene, die von dieser Norm abweichen, “neurodivergent” sind. Diese neurologische Vielfalt (Neurodiversität) wird als natürlicher Teil der menschlichen Vielfalt angesehen.
Das Konzept der Neurodiversität zeigt Parallelen und Verbindungen zum sozialen Modell von Behinderung. Bei diesem Modell wird Behinderung ebenfalls nicht als negative, heilungsbedürftige Eigenschaft einer Person angesehen. Sie reflektiert einen Teil der Identität eines Menschen, genauso wie beispielsweise Herkunft und Geschlecht. Der Mensch wird durch physische und unsichtbare Barrieren in einer für ihn nicht passenden Umwelt behindert.
- Gesellschaft (Grund):
Die menschliche Gesellschaft richtet sich nach gewissen Normen, die meist dem neurotypischen Maßstab angelehnt sind. Jedoch können manche dieser Normen von neurodivergenten Personen oft nicht oder nur mit Mühe eingehalten werden.
Aus diesem Grund wollen wir als Verein erreichen, dass das Verständnis der Gesellschaft erweitert wird und starre Muster aufgebrochen werden. Um Barrieren für autistische Menschen zu vermindern, bedarf es einer Annäherung. Unter anderem möchten wir mit unserem Projekt „Aut of the Box“ autistischen Personen die Möglichkeit bieten, uns an ihren Biografien teilhaben zu lassen, damit sie von der Gesellschaft gehört werden können. Ergänzend können neurotypische Personen in unserem Erfahrungsraum Autismus “erleben”, um künftig besser darauf Rücksicht nehmen zu können.
- Verein (Was wollen wir erreichen, was tun wir?):
Einerseits wurde der Verein gegründet, um die in Österreich fehlenden Maßnahmen zur Sensibilisierung und Reduzierung von Hürden für Menschen im Autismus-Spektrum zu fördern. Andererseits ist das Thema Autismus in der Öffentlichkeit generell weitgehend unbekannt. Wir haben uns als Verein vorgenommen, diese Probleme so effektiv wie möglich anzugehen und zu verbessern. Autismus wird oft, basierend auf veralteten Informationen und Statistiken, falsch verstanden. Einfach gesagt, eines der größten Hindernisse für autistische Menschen sind Vorurteile und Verallgemeinerungen.
Sensibilisierung bedeutet für uns einen Perspektivenwechsel und das Eintauchen in die Wahrnehmungs-, Gefühls- und Gedankenwelt von autistischen Personen. Wir möchten die Chance bieten, dass alle Menschen ein Stück weit „Autismus-Allies“4 werden können.
Zusätzlich können sie Ideen aus Angeboten mitnehmen, wie sie im Alltag angemessen reagieren und unterstützend wirken können.
Begrifflichkeiten:
- Wir respektieren Selbstzuschreibung
Selbstzuschreibung (auch Selbstidentifikation) bezeichnet den Prozess, durch den eine Person ihre Identität, ihre Eigenschaften oder Zugehörigkeiten selbst beschreibt und definiert. Im Kontext von Autismus bedeutet Selbstzuschreibung, dass eine autistische Person ihr eigenes Selbstbild und ihr Erleben auf eine Weise ausdrückt, die ihrer eigenen Wahrnehmung und ihrem Verständnis entspricht. Wichtige Aspekte: 1. Autonomie und Selbstbestimmung: Selbstzuschreibung respektiert die Autonomie und das Recht jeder Person, ihre eigene Identität und ihr Erleben selbst zu definieren und zu benennen. 2. Individuelle Unterschiede: Autistische Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven. Ihre Selbstzuschreibung kann daher stark variieren und individuell einzigartig sein. 3. Anerkennung und Respekt: Die Gesellschaft und insbesondere unterstützende Organisationen sollen die Selbstzuschreibung respektieren und anerkennen, um ihre Würde und Identität zu wahren. |
In unserem Verein legen wir großen Wert auf die Selbstzuschreibung und Selbstbestimmung autistischer Menschen. Wir erkennen an, dass jede Person ihre eigene Identität sowie ihr Erleben auf einzigartige Weise beschreibt. Unser Ziel ist es, eine unterstützende Umgebung zu schaffen, in der alle Menschen die Freiheit und das Recht haben, ihre persönliche Identität selbst zu definieren und auszudrücken.
- (Entwicklungs-) Störung
Störung bezeichnet im medizinischen und psychologischen Kontext eine Abweichung von der typischen oder erwarteten Entwicklung und Funktion. Im Zusammenhang mit Autismus bezieht sich der Begriff „Störung“ auf die Autismus-Spektrum-Störung (ASS), eine neurologische Entwicklungsstörung. Sie zeichnet sich durch Unterschiede in der sozialen Interaktion, Kommunikation und durch eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensmuster aus. Wichtige Aspekte: 1. Neurologische Grundlage: Autismus wird als eine neurologische Entwicklungsstörung verstanden. Das bedeutet, dass die Unterschiede im Gehirn liegen und von Geburt an vorhanden sind. 2. Spektrum: Der Begriff „Spektrum“ betont, dass Autismus in einer Vielzahl von Ausprägungen und Schweregraden vorkommt. Autistische Menschen haben unterschiedliche Stärken und Herausforderungen, und ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten können stark variieren. |
In unserem Verein verstehen wir Autismus als einen alternativen Entwicklungspfad des Gehirns, der das Leben und die Wahrnehmung der Betroffenen auf vielfältige Weise beeinflusst. Wir erkennen die einzigartigen Stärken und Herausforderungen jeder einzelnen Person an. Außerdem setzen wir uns dafür ein, ihre Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern und ihre Lebensqualität zu verbessern.
- Behinderungen
| Behinderungen betreffen Menschen, die langfristige körperliche, psychische, intellektuelle oder Sinnesbeeinträchtigungen haben. Diese können, in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren, ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft behindern (UN-Behindertenrechtskonvention 2016). Im Kontext von Autismus wird der Begriff häufig verwendet, um die Herausforderungen zu beschreiben, denen Betroffene gegenüberstehen. Allerdings kann er auch negativ konnotiert sein und eine unvollständige oder defizitorientierte Sichtweise vermitteln. Wichtige Aspekte: 1. Negative Konnotationen: Der Begriff „Behinderung“ wird oft negativ verwendet und kann das Bild vermitteln, dass Menschen mit Behinderungen weniger wertvoll oder weniger fähig sind. Dies widerspricht dem Ansatz, der die Vielfalt menschlicher Erfahrungen und Fähigkeiten anerkennt und wertschätzt. 2. Gesellschaftliche Barrieren: Viele Menschen im Autismus-Spektrum sehen sich nicht unbedingt selbst als „behindert“, sondern erleben ihre Behinderung oft als das Ergebnis von gesellschaftlichen Barrieren und fehlendem Verständnis. Diese Barrieren entstehen häufig durch mangelnde Inklusion und Anpassung der Umwelt an ihre Bedürfnisse. 3. Einsatz für Barrierefreiheit und Inklusion: Anstelle von einem defizitorientierten Ansatz auszugehen, sollte der Fokus auf dem Abbau von Barrieren liegen, um eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. |
In unserem Verein verstehen wir den Begriff „Behinderung“ als eine Beschreibung von Einschränkungen, die häufig durch gesellschaftliche Barrieren und mangelnde Inklusion verursacht werden. Wir distanzieren uns von einer negativen oder defizitorientierten Sichtweise. Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass Menschen im Autismus-Spektrum nicht durch gesellschaftliche Strukturen behindert werden. Unser Ziel ist es, Barrieren abzubauen, um eine inklusive und unterstützende Gesellschaft zu fördern, in der alle Menschen, unabhängig von ihren neurologischen Unterschieden, möglichst gleichberechtigt teilnehmen können.
- Leiden
| Leiden bezeichnet das Erleben von Schmerz, Unbehagen oder erheblichem Stress, der durch physische, emotionale oder soziale Umstände verursacht werden kann. Im Zusammenhang mit Autismus kann der Begriff „Leiden“ verschiedene Aspekte umfassen, sollte jedoch mit Sensibilität und Präzision verwendet werden. Wichtige Aspekte: 1. Subjektives Erleben: Leiden ist eine subjektive Erfahrung und kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Nicht alle autistischen Menschen empfinden ihre neurologische Unterschiedlichkeit als Leiden. 2. Kontextabhängig: Das Leiden von Menschen im Autismus-Spektrum kann durch externe Faktoren wie soziale Isolation, fehlendes Verständnis, mangelnde Unterstützung und Barrieren in der Umwelt verstärkt werden. 3. Nicht intrinsisch: Autismus selbst muss nicht zwangsläufig mit Leiden verbunden sein. Viele Menschen im Autismus-Spektrum führen ein erfülltes und glückliches Leben. Das Leiden resultiert oft aus den Reaktionen und Hürden der Gesellschaft sowie aus Missverständnissen und fehlender Akzeptanz. |
In unserem Verein erkennen wir an, dass das Leiden von Menschen im Autismus-Spektrum oft durch äußere Umstände und fehlende Unterstützung verursacht wird. Gleichzeitig respektieren wir, dass viele autistische Menschen sich selbst nicht als leidend betrachten. Unser Ziel ist es, durch Aufklärung, gezielte Unterstützung und den Abbau von Barrieren das Wohlbefinden und die Lebensqualität für alle zu verbessern. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen im Autismus-Spektrum in einer verständnisvollen und inklusiven Gesellschaft leben können. So können sie ihre Potenziale entfalten und ein erfülltes Leben führen.
- Person first – Identity first
| Person-First Language und Identity-First Language sind zwei verschiedene Ansätze, wie Menschen im Zusammenhang mit ihrer Behinderung angesprochen werden sollten. Person-First Language (personzentrierte Sprache) stellt die Person in den Vordergrund, bevor die Behinderung erwähnt wird. Dies betont, dass es in erster Linie um die Person und nicht um ihre Behinderung geht – ihre Behinderung stellt nur einen Aspekt ihres Lebens dar. Beispiele: – Person mit Autismus – Kind im Autismus-Spektrum Identity-First Language (identitätszentrierte Sprache) stellt die Behinderung in den Vordergrund und erkennt sie als einen integralen Teil der Identität der Person an. Viele Menschen im Autismus-Spektrum bevorzugen diese Form5, da sie ihre neurologische Andersartigkeit als zentralen Teil ihres Selbstverständnisses sehen und nicht als etwas, das von ihrer Person getrennt ist. Beispiele: – Autistische Person – Autistisches Kind |
In unserem Verein respektieren und unterstützen wir sowohl die Verwendung von „Person-First“-, als auch von „Identity-First“-Sprache. Wir erkennen an, dass einige Menschen es vorziehen, als “Person mit Autismus“ bezeichnet zu werden, während andere sich als “autistische Person“ identifizieren. Unser Ziel ist es, die individuellen Präferenzen und Identitäten aller Betroffenen zu respektieren. Indem wir eine inklusive und respektvolle Sprache verwenden, erkennen wir ihre Würde und Identität an.
- Asperger-Syndrom
| Asperger-Syndrom galt lange Zeit als Diagnose innerhalb des Autismus-Spektrums. Diese war durch Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion sowie durch eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensmuster gekennzeichnet. Allerdings ohne signifikante Verzögerungen in der sprachlichen oder kognitiven Entwicklung. Das Asperger-Syndrom wurde nach Dr. Hans Asperger benannt, einem österreichischen Kinderarzt, dessen Forschungen im Bereich Autismus maßgeblich waren. Aufgrund seiner Verbindungen zum nationalsozialistischen Regime und den daraus resultierenden ethischen Bedenken werden seine Leistungen aber auch kritisch betrachtet. Wichtige Aspekte: 1. Historische Diagnose: Das Asperger-Syndrom war eine spezifische Diagnose innerhalb des Autismus-Spektrums nach DSM-IV und ICD-10. 2. Änderung der Klassifikation: Im DSM-5 und im neuen ICD-11 wird das Asperger-Syndrom nicht mehr als separate Diagnose geführt. Stattdessen wird es unter dem Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ (ASS) subsumiert. 3. Kontroverse um Dr. Hans Asperger: Dr. Hans Aspergers Arbeit steht im Zusammenhang mit ethischen Kontroversen, die auf seine Verbindungen zum nationalsozialistischen Regime zurückzuführen sind. 4. Selbstidentifikation: Viele Menschen, die vor der Änderung der Klassifikation diagnostiziert wurden oder sich mit den Merkmalen des Asperger-Syndroms identifizieren, verwenden weiterhin diesen Begriff, um ihre Erfahrungen und Identität zu beschreiben. |
In unserem Verein erkennen wir die historische Bedeutung und die aktuelle Kontroverse um das Asperger-Syndrom an. Obwohl das Asperger-Syndrom im neuen ICD-11 nicht mehr als separate Diagnose angeführt wird und nun unter den Begriff “Autismus-Spektrum-Störung” (ASS) fällt, respektieren wir die Selbstidentifikation von Menschen, die sich weiterhin als “Asperger” bezeichnen möchten. Wir sind uns auch der ethischen Kontroversen um Dr. Hans Asperger bewusst und betrachten diese kritisch im Kontext der Geschichte. Unser Ziel ist es, eine respektvolle und inklusive Umgebung zu schaffen, in der alle Menschen, unabhängig von ihrer spezifischen Diagnose oder Selbstbezeichnung, willkommen sind und Unterstützung finden.
- Gender
| Gender (Geschlecht) bezeichnet die sozialen, kulturellen und individuellen Vorstellungen und Rollen, die einer Person aufgrund ihres Geschlechts zugeschrieben werden. Es unterscheidet sich vom biologischen Geschlecht, das auf physischen Merkmalen basiert. Gender umfasst ein breites Spektrum von Identitäten und Ausdrucksweisen, die über die traditionellen Kategorien von männlich und weiblich hinausgehen. Wichtige Aspekte: 1. Soziale Konstruktion: Gender wird durch gesellschaftliche Normen und kulturelle Praktiken geformt und kann sich je nach kulturspezifischem Kontext und historischem Zeitraum unterscheiden. 2. Forschungsergebnisse: Studien haben gezeigt, dass Menschen im Autismus-Spektrum häufiger dazu neigen, sich als non-binär, genderqueer, genderfluid oder auf andere Weise zu identifizieren, die nicht in das konventionelle binäre Geschlechtssystem passen. Einige Studien haben ergeben, dass eine höhere Häufigkeit von non-binären Identitäten bei autistischen Menschen beobachtet wird. 3. Selbstwahrnehmung und Identität: Die Selbstwahrnehmung und das Verständnis von Gender können bei Menschen im Autismus-Spektrum vielfältig und komplex sein. Dies kann durch unterschiedliche Erfahrungen mit sozialer Interaktion, Kommunikationsstile und Wahrnehmung beeinflusst werden. 4. Eingeschränkte Forschung: Es ist wichtig zu beachten, dass die Forschung zu Gender und Autismus noch relativ jung ist und es an umfassenderen Studien mangelt. Daher ist es möglich, dass die Wissenschaft in Zukunft zusätzliche Erkenntnisse liefert und bestehende Ergebnisse präzisieren kann. |
In unserem Verein erkennen wir die Vielfalt der Gender-Identitäten an und respektieren diese. Wir setzen uns dafür ein, eine inklusive und unterstützende Umgebung zu schaffen, in der alle Menschen unabhängig von ihrer Gender-Identität willkommen sind und sich frei ausdrücken können. Unser Ziel ist es, Stereotypen und Diskriminierung abzubauen. Wir möchten Gleichberechtigung für alle Menschen fördern, unabhängig davon, wie sie sich identifizieren oder ihre Gender-Identität ausdrücken. Wir sind uns jedoch bewusst, dass wir trotz unseres Engagements für Inklusion und Vielfalt nicht immer eine gendergerechte Sprache verwenden können, die alle Identitäten vollständig umfasst. Wir bitten um Verständnis und setzen uns weiterhin dafür ein, unsere Sprache und unsere Praxis so inklusiv wie möglich zu gestalten.
- Individualisierung
| Individualisierung bezieht sich auf die Anpassung von Unterstützung, Ressourcen und Maßnahmen an die einzigartigen Bedürfnisse, Stärken und Präferenzen jeder einzelnen Person. Im Kontext von Autismus bedeutet dies, dass jede autistische Person als einzigartig betrachtet wird und daher maßgeschneiderte Unterstützung erhält, die ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. Wichtige Aspekte: 1.Einzigartigkeit jeder Person: Jeder autistische Mensch ist einzigartig und kann unterschiedliche Stärken, Herausforderungen und Bedürfnisse haben. Individualisierung anerkennt diese Unterschiede und passt die Unterstützung entsprechend an. 2. Nicht-Kategorisierung: Das Sprichwort „Kennst du eine autistische Person, dann kennst du genau EINE autistische Person“ verdeutlicht, dass Betroffene nicht pauschalisiert oder auf Basis ihrer Symptome gleichgestellt werden sollten. Jeder Mensch ist ein Individuum mit eigenen Erfahrungen und Perspektiven. 3. Personalisierte Unterstützung: Individualisierung bedeutet, dass die Unterstützung und Maßnahmen so gestaltet werden, dass sie den spezifischen Anforderungen und Wünschen der jeweiligen Person gerecht werden, anstatt allgemeine Ansätze anzuwenden. 4. Flexibilität und Anpassung: Die Herangehensweise muss flexibel sein, um sich an die möglicherweise verändernden Bedürfnisse und Präferenzen der Person anzupassen. |
In unserem Verein legen wir großen Wert auf Individualisierung. Unsere Bemühungen beruhen darauf, die Gesellschaft für die Bedürfnisse und Perspektiven von autistischen Menschen zu sensibilisieren und zu formen. Wir erkennen an, dass jeder Mensch einzigartig ist und unterschiedliche Stärken, Bedürfnisse und Präferenzen in sich trägt. Unser Ansatz basiert auf dem Verständnis: „Wenn du eine autistische Person kennst, dann kennst du genau EINE autistische Person”. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass unsere Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen auf die vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven von autistischen Menschen abgestimmt sind. Unser Ziel ist es, eine inklusive Gesellschaft zu fördern, die die Einzigartigkeit jedes Einzelnen anerkennt und respektiert.
Abschließende Worte:
Unser größtes Anliegen ist, die Lebensrealität von Menschen im Autismus-Spektrum besser zu verstehen, ihre Vielfalt zu würdigen und ihre Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen zu unterstützen.
Fußnoten:
- Pathologisierung: “(eine Verhaltensweise, eine Empfindung o. Ä.) als krankhaft bewerten, für krankhaft halten” (Duden für “pathologisieren”, Stand 04.10.2024) ↩︎
- Diskriminierung: “(durch unterschiedliche Behandlung) benachteiligen, zurücksetzen; (durch Nähren von Vorurteilen) verächtlich machen” (Duden für “diskriminieren”, Stand 04.10.2024) ↩︎
- Stigmatisierung: “etwas, wodurch etwas oder jemand deutlich sichtbar in einer bestimmten, meist negativen Weise gekennzeichnet ist und sich dadurch von anderem unterscheidet” (Duden für “Stigma”, Stand 04.10.2024) ↩︎
- Ally/Allies: Der Begriff „Ally“ bezieht sich auf eine Person, die eine andere Person oder Gruppe unterstützt, ohne selbst Teil dieser Gruppe zu sein. Im Kontext von Autismus bedeutet dies, dass die Person sich für die Rechte und das Wohl autistischer Menschen einsetzt, ohne selbst autistisch zu sein. Für Allys stehen Inklusion, Verständnis und Akzeptanz im Mittelpunkt. Sie arbeiten aktiv daran, Vorurteile abzubauen und die autistische Gemeinschaft zu unterstützen. (siehe Instagram-Post) ↩︎
- https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/13623613221130845?journalCode=auta ↩︎